Anlässlich des Museumstages 2024 finden Sie die kommenden drei Tage ein exklusives digitales Angebot aus […]
29. April – Welttanztag
In ganz Lateinamerika lassen sich eine Vielzahl regionaler Tänze finden. Diese spiegeln Kultur und Gesellschaft […]
Tanz – Merengue

Unter Merengue versteht man einen aus der Dominikanischen Republik stammenden Tanz und die dazugehörige Musikrichtung.
Bis in die Mitte des 19. Jahrunderts war Merengue nur der Landbevölkerung ein Begriff, in städtischen Salons blieb der Tanz unbekannt.
Durch den Diktator Rafael Trujillo wurde der Tanz schließlich in den 1930er Jahren ein beliebtes Propagandamittel und er erwies sich als Förderer der Musik. Allerdings ordnete er an, die Musik mehr zu europäisieren, indem mehr Orchesterinstrumente verwendet werden sollten. Außerdem wurde die Musik in staatlichen Radiosendern gespielt und so immer bekannter gemacht. Darüber hinaus wurden Bälle und Merengue-Festivals veranstaltet.
Schließlich blieb der Tanz auch nach dem Tod des Diktators beliebt und wurde zum Kulturgut. Im Juli ist das „Festival de Merengue“ der wichtigste Merengue-Wettbewerb und ist auch mit dem Nationalfeiertag am 25. Juli verknüpft.
Weitere wichtige Merengue-Festivals gibt es noch in den USA in Miami sowie im venezolanischen Merengue.
Bei Merengue handelt es sich um Musik im Zwei-Viertel-Takt, wobei jeder Taktschlag mit einem Trommelschlag stark betont wird. Wichtige Instrumente waren erst Tamboras, Güiras und später noch das Akkordeon. Traditionelle Combos bestehen aus bis zu vier Musikanten und werden „Perico Ripiaos“ genannt. Mit dem Einzug des Merengue in die Städte kamen weitere Instrumente wie Blechblasinstrumente hinzu. Es gibt auch moderne Mischformen mit Hip-Hop-Elementen und elektronischer Musik. Merengue ist ein Paartanz mit gleichmäßigen Schritten nach vorne, hinten und zur Seite bei den Taktschlägen. Zudem werden markante Hüftbewegungen bei jedem Taktschlag gemacht. Bei Drehungen werden mit den Armen aufwendige Figuren erzeugt, wobei diese Figuren von den Dominikanern zumeist abgelehnt werden.
mh
Lateinamerika und Deutschland
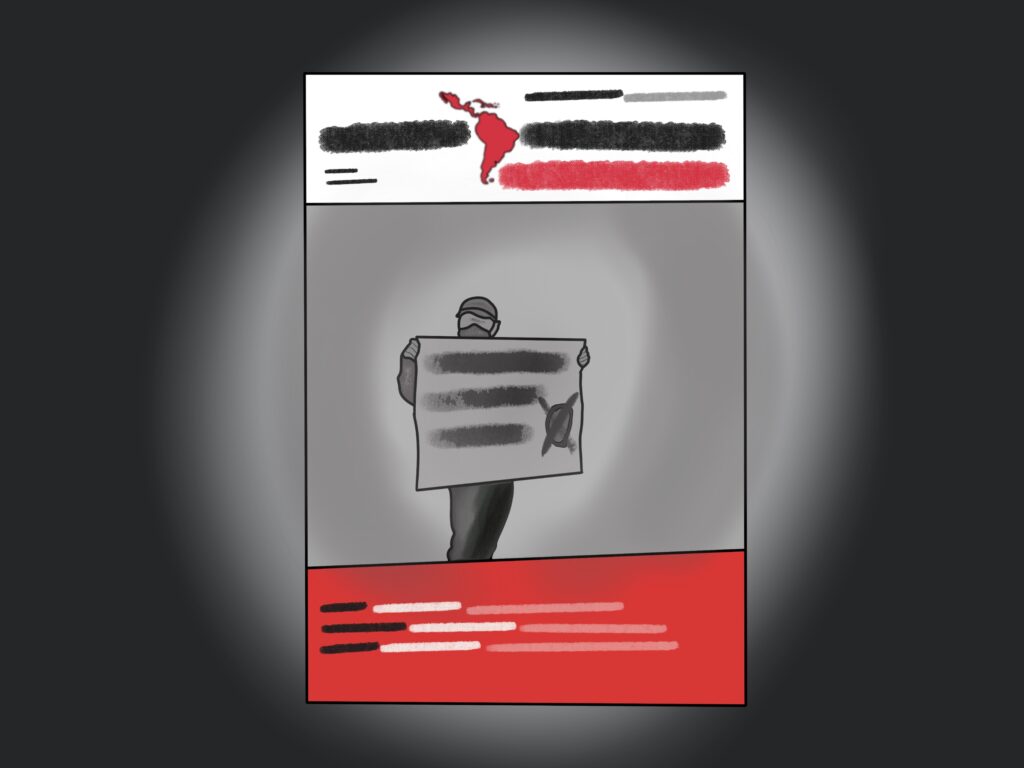
Das Interesse an lateinamerikanischen Themen ist in Deutschland ebenso groß wie die Vielfalt, dieses Interesse zu bedienen. Durch Musik, Tanz, Film und Fernsehen sowie Kulinarisitk werden auch in Deutschland gewisse mal mehr, mal weniger stereotype Vorstellungen von Lateinamerika transportiert und vermittelt.
Da Lateinamerika in den großen Medien oftmals stiefmütterlich behandelt, wenn nicht gerade eine Wahl bevorsteht oder ein bekannter Narco dingfest gemacht wurde, haben sich anderweitig Informationsstellen für spezifische Klientel etabliert. Dazu gehört zum Beispiel die Monatszeitschrift „Lateinamerika Nachrichten“ nach deren Layout die oben gezeigte Illustration erstellt wurde.
Darüber hinaus gibt es aber auch Kulturvereine, die hauptsächlich von Personen repräsentiert werden, die einen Bezug zur entsprechenden Gesellschaft haben, zum Beispiel weil sie dort geboren wurden, dort gearbeitet haben oder anderweitig Expertise entwickelt haben.
mh
Schreibe einen Kommentar
Musik – Huni Kuin-Gitarre

terralat bedankt sich herzlich bei Inu Keã Huni Kuin für die Interpretation und Bereitstellung des Liedes.
Der Interpret
Inu Keã Huni Kuin ist ein junger Sänger aus dem Dorf Boa Vista am Rio Jordão. Er stammt aus einer Familie von kulturellen Anführern und ist ein Schüler seines Vaters, einem respektierten Kräuterheiler.
Das Lied
Dies ist eine von vielen Versionen eines Liedes, welches die Boa als Herrin der verschiedenen Sphären des Kosmos preist. Es wird unter anderem am Ende von Zeremonien mit nixi pae gesungen, um die Anwesenden von der psychedelischen Wirkung und Krankheiten im Allgemeinen zu heilen.
Die Gitarre ist ein Instrument, das mit den portugiesischen Kolonisatoren zu den Huni Kuin kam, einer indigenen Gesellschaft im westlichen Amazonien.
Der erste Kontakt mit nicht-Indigenen ereignete sich vermutlich Anfang des 20. Jahrhunderts, als Kautschukzapfer in das Grenzgebiet zwischen Peru und Brasilien strömten. Für die Huni Kuin bedeutete dies zunächst Gewalt und Vertreibung, schließlich die faktische Versklavung als Arbeitskräfte für Kautschukhändler.
In den folgenden Jahrzehnten gaben sie viele ihrer kulturellen Praktiken auf, teils, um sich vor Diskriminierung zu schützen und teils, da ihnen manche Praktiken verboten wurden. Nach Erringung von Landrechten ab den 1980er Jahren blüht die Kultur der Huni Kuin jedoch wieder auf und wird durch ein kollektives Bemühen wiederbelebt. Dabei fungieren alte Huni Kuin, die das Wissen ihrer Vorfahren im Geheimen bewahrt haben, als Lehrmeister*innen, während eine junge Generation Wege findet, Tradition mit Innovation zu verbinden.
Die hier ausgestellte Gitarre steht sinnbildlich für diesen Prozess und gleichzeitig für die enorme Bedeutung der Musik in ihm. Sie ist das Lieblingsinstrument der jungen Sängerinnen und Sänger. Viele beginnen schon im Alter von sechs Jahren, Gitarre zu spielen, um es später ihren älteren Verwandten gleichzutun, die seit Anfang der 2010er Jahre international gefragt sind. Das globale Interesse am amazonischen Schamanismus und insbesondere dem psychedelischen Trank Ayahuasca sind die Grundlagen des Erfolgs von Sängerinnen und Sängern, die Ayahuasca-Rituale und weitere Praktiken der Huni Kuin mit älteren, rein vokalen Liedern und neueren Kreationen mit der Gitarre begleiten.
Es sind diese globalen Verflechtungen, durch die die Gitarre meistens in Form von Geschenken in die Dörfer der Huni Kuin wandert, wo sie manchmal mit geometrischen Mustern oder figürlichen Darstellungen verziert wird, um sie als ein Stück der Kultur der Huni Kuin auszuweisen. Auf dem obigen Bild ist sie mit der weißen Boa Constrictor versehen, welche für die Huni Kuin die Hüterin des Wissens um Ayahuasca ist. Auch repräsentiert sie durch die Fähigkeit, sich zu häuten, Unsterblichkeit. In Ritualen hört man oft das Motto: „a jiboia não para“, die Boa hört nicht auf. Damit ist sie der Musik und der Kultur der Huni Kuin gleich – durch die Transformation bleibt sie am Leben.
Felix Uhl (Philipps-Universität Marburg)
Literatur
Keifenheim, Barbara (1999): „Zur Bedeutung Drogen-induzierter Wahrnehmungs veränderungen bei den Kashinawa-Indianern Ost-Perus“. Anthropos 94 (4): 501–514.
Lagrou, Els (2018): „Anaconda-Becoming. Huni Kuin Image-Songs, an Amerindian Relational Aesthetics”. Horizontes antropológicos 51: 17–49.
Meneses, Guilherme Pinho (2018): “Medicinas da floresta. Conexões e conflitos cosmo-ontológicos”. Horizontes antropológicos 51: 229–258.
Haibara de Oliveira, Alice (2016): Já me transformei. Modos de circulação de pessoas e saberes entre os Huni Kuin (Kaxinawá). Unveröffentlichte Masterarbeit. Universidade de São Paolo.
Schreibe einen Kommentar
Raum 03.5 – Musik, Tanz und Tracht

Musik, Tanz und Tracht
Musik und Tanz repräsentieren eigene Kulturerrungenschaften und sind oftmals Teil der eigenen Geschichtstradierung und -verarbeitung. Sie nehmen Bezüge auf die Conquista und die eigene Weltanschauung und Geschichte.
Musiziert wird oft mit sogenannten autochthonen Instrumenten sowie mit Instrumenten westlichen Ursprungs. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Trachten, die sowohl im Alltag als auch zu besonderen Anlässen Anwendung finden, wie z.B. bei Tänzen, beim Musizieren oder beim Durchführen bestimmter Rituale. Diese sind mit lokalen Mustern und bestimmten Farben verziert, die ebenfalls bestimmte Inhalte vermitteln oder eine bestimmte Region repräsentieren. Dazu zählen unter anderem Symbole für Flora und Fauna.


Schreibe einen Kommentar